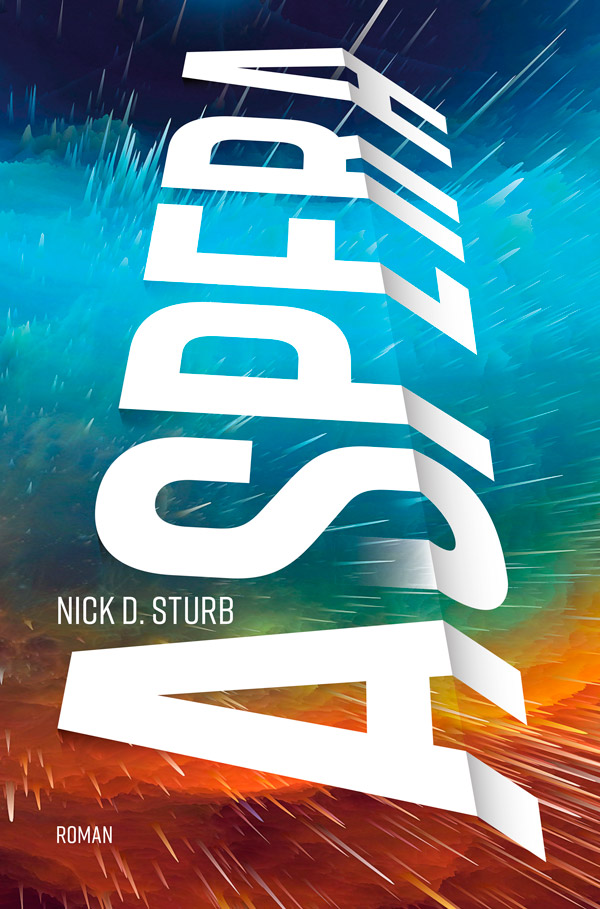Fragment 4 – Das Mädchen in der Gasse
Verdammt! So hatte er sich seine Reise in die USA nicht vorgestellt. Ja, er wollte in den knapp drei Monaten vor Beginn seines Studiums noch einiges erleben und die Welt sehen, aber das war meilenweit von dem entfernt, was in den vergangenen Stunden geschehen war.
Er wischte sich das Blut der Platzwunde aus den Augen. Sein Kopf schmerzte höllisch, und es kostete ihn einige Überwindung, diesen zu heben und sich umsehen. Das Bild, welches sich ihm bot, schien direkt aus einem Horrorfilm zu stammen. Vier bis an die Zähne bewaffnete und durch Kampfanzüge gepanzerte Männer lagen wie unachtsam weggeworfener Abfall vor ihm und färbten mit ihrem Blut die stetig größer werdenden Regenpfützen rot ein. Er schloss die Augen. Die Gedanken an die letzten Stunden kamen ihm so unwirklich vor, dass ihm schwindelte.
Nach seiner Ankunft am Flughafen in Newark und den eher lästigen als komplizierten Einreiseformalitäten hatte er nach einem günstigen Weg in die Stadt gesucht. Zwar war es ihm ohne weiteres möglich, sich ein Taxi zu nehmen, aber die Reisekasse schon am Anfang seines Trips mit beiden Händen zu leeren kam nicht in Frage. Dazu boten die nächsten Tagen und Wochen noch genügend Gelegenheit. Er trat durch die Automatiktüren des klimatisierten Terminals hinaus in den ebenfalls angenehm warmen Augustnachmittag. Vom angekündigten Regen war weit und breit nichts zu sehen. Er lächelte.
Links und rechts standen die Taxen Stoßstange an Stoßstange dicht beieinander. Er seufzte und sah bereits seine Barschaft schwinden. Dann jedoch entdeckte er einen weißen Lieferwagen, der halb auf dem Gehweg parkte. Vor den geöffneten Hecktüren stand eine junge Frau, die gerade dabei war, einen Berg leerer Kisten und Verpackungsmaterial von zwei großen Rollwagen in das Fahrzeug zu laden. Sie trug abgewetzte Jeans und ein weißes Shirt mit einem farbigen Aufdruck, der an einigen Stellen ausgeblichen war und anfing abzublättern. Er atmete tief durch und steuerte in ihre Richtung. Sie arbeitete zügig, und als er ankam, war der erste Rollwagen bereits leer. Auf die Frage, wie er am schnellsten nach Manhattan käme, zögerte sie kurz, aber dann stahl sich ein Lächeln auf ihr Gesicht.
»Wenn du mir eben mit dem Rest hier hilfst, ist dir deine Fahrt in die Stadt sicher.«
Er nickte.
»Klar!«
Er stellte den brandneuen Trekkingrucksack auf den Beifahrersitz und half ihr, die restlichen Kisten einzuladen. Nach zehn Minuten waren sie fertig, hatten die Rollwägen zurückgebracht und fuhren vom Express Drive auf den Highway 1 in Richtung Norden. Als sie in den zweieinhalb Kilometer langen Holland Tunnel, der unter dem Hudson River nach Manhattan führte, einbogen, fielen ihm die unzähligen Fliesen auf, mit denen Wände und Decke verkleidet waren.
»Wow!«
Seine Fahrerin lachte auf.
»Die Fliesen?«
»Ja … ich meine … wie viele sind das?«
»Tja. Keine Ahnung. Stammen von einem Unternehmen aus Deutschland. Wie hießen die doch gleich?«
Sie überlegte kurz.
»Ach ja. Villeroy & Boch. Die haben im Übrigen auch große Teile des Innenraums der Titanic ausgestattet.«
Irritiert sah er sie an.
»Tatsächlich? Ich habe in meiner Wohnung ein Waschbecken von denen … glaube ich und überhaupt: Wie kommt es, dass so jemand wie du davon weißt?«
Jetzt war es an ihr, ihn irritiert anzusehen. Zusätzlich schob sich eine ihrer Augenbrauen nach oben.
»So jemand … wie ich?«
Mist. Nicht mal zwei Stunden hier und wahrscheinlich gerade in ein Fettnäpfchen von der Größe des Eisbergs getreten, der die Titanic damals auf den Grund des Nordatlantiks befördert hatte.
»Eh …«
Er spürte, wie das Blut in seine Wangen schoss.
»Sorry. Das meinte ich nicht so. Ich …«
Weiter kam er nicht, denn seine Fahrerin lachte lauthals los. Und es dauerte mehr als einen Augenblick, bevor sie sich wieder beruhigt hatte.
»Entschuldige bitte, aber dein Gesichtsausdruck eben sprach Bände. Also …«, fuhr sie fort.
»So jemand wie ich … finanziert sich mit einem Nebenjob das Studium. Anderer Leute Verpackungsmaterial durch die Gegend fahren, sehe ich nicht wirklich als meine Berufung an.«
»Okay. Verstanden.«
Ihm fiel ein Stein vom Herzen, denn offensichtlich hatte sie nicht vor, ihn wegen seiner Begriffsstutzigkeit mitten im Tunnel aussetzen.
»Und was studierst du?«
»Architektur und Design am New York Institute of Technology. Und du? Was ist mit dir?«
»Mit mir?«
Sie ließ ihren Blick durch die Fahrerkabine schweifen, nur um ihn dann am Ende mit gespielter Überraschung wieder anzusehen.
»Ja? Oder denkst du, ich erzähle einem Wildfremden meine Lebensgeschichte und gehe dann leer aus?«
Er zuckte mit den Achseln.
»Okay. Aber – so viel habe ich gar nicht zu erzählen. Ich bin vor einem Monat mit meiner Ausbildung fertig geworden und überbrücke die Zeit bis zum Beginn des Studiums mit einer USA Reise.«
»Das wirft ja mehr Fragen auf, als es beantwortet. Deine Ausbildung. Worin bestand die? Und was wirst du studieren?«
Mittlerweile hatten sie den Tunnel hinter sich gelassen und schoben sich mehr in Richtung Lower Manhattan, als sie fuhren.
»Nach der Schule … Konstruktionsmechaniker in einer Werft bei Hamburg. Studieren wollte ich da noch nicht, sondern erst etwas Geld verdienen. Leider sind die dann kurz, nachdem ich meine Ausbildung abgeschlossen hatte, Pleite gegangen.«
»Oh, das tut mir leid.«
»Ach, schon okay. Letzten Endes war es gut so. Ich fange in drei Monaten mein Maschinenbau-Studium an. Und danach … wer weiß?«
Er lächelte. Sie tat es ihm gleich.
»Dann wünsche ich dir bei deinen Zukunftsplänen alles Gute. Und – ich fürchte, hier trennen sich unsere Wege schon wieder. Ich lasse dich da vorne nach der Kreuzung raus, okay?«
»Eh … ja klar.«
Der Transporter hielt am Straßenrand. Bevor er ausstieg, streckte er die Hand über den Rucksack zu ihr hinüber.
»Ich … ich bin Ben.«
Sie sah ihn an und zögerte kurz. Dann ergriff sie die angebotene Hand.
»Freut mich dich kennengelernt zu haben, Ben.«
Mehr sagte sie nicht. Als er ausgestiegen war, bedankte er sich abermals für die Mitfahrgelegenheit und schloss die Beifahrertür. Sie schenkte ihm ein erneutes Lächeln, nickte und ordnete sich in die Wagenkolonne ein. Nicht, ohne dabei ein genervtes Hupen eines von hinten herannahenden Taxis heraufzubeschwören. Als sie wenig später im Verkehr verschwunden war, wanderte sein Blick zu einem in der Nähe hängenden Straßenschild. Canal Street. Er zog den Reiseführer aus der Außentasche seines Rucksacks und blätterte darin herum, bis er die Seiten mit den Kartendarstellungen gefunden hatte.
»Scheiße …«
Zwar hatte er eine kostenlose Mitfahrgelegenheit in die Stadt bekommen, aber bis zu seinem Hotel, das in der Nähe des Central Parks lag, brauchte er von hier aus mindestens vierzig Minuten. Er seufzte.
Die nächste U-Bahn-Station lag laut Reiseführer zum Glück nur ein paar Gehminuten entfernt und so beschloss er, kurz durch Chinatown zu schlendern. In den überfüllten Straßen reihten sich unzählige Geschäfte. Die meisten davon boten eine sich ständig wiederholende Auswahl an klassischen New Yorker Souvenirs an. Nach dem gefühlt zehntausendsten T-Shirt mit dem bekannten ›I Love NY‹-Aufdruck – er hatte gelesen, dass die Stadt New York alleine mit den Lizenzen pro Jahr knapp zwei Millionen Dollar einnahm – bog er in eine Seitenstraße. Von einer Sekunde auf die nächste fand er sich in einer anderen Welt wieder. Zu beiden Seiten boten Händler unter farbenfroh überdachten Ständen exotische Früchte und Gemüse feil, gefolgt von Fischen und allerlei Meeresfrüchten, die so frisch aussahen, als wären sie vor Kurzem noch an Bord eines Fischerbootes gewesen. Zwischen den Ständen erhaschte er immer wieder einen Blick auf rot gebeizte Enten, die in den Schauvitrinen der Restaurants und Imbisse hingen. Von überall her drangen chinesische Wortfetzen an sein Ohr und auf den Gehwegen drängten sich die Menschen. Mit Einsetzen der Dämmerung erwachten die über die Straße gespannten Lampions und die zahllosen Neonschilder der Geschäfte zum Leben und verwandelten Chinatown vollends in eine andere Welt.
Sein Magen meldete sich.
Da er seit Beginn seiner Reise, abgesehen von der eher überschaubar ausgefallenen Mahlzeit im Flugzeug, nichts gegessen hatte, steuerte er eine der zahlreichen Suppenküchen an. Kurze Zeit später ließ er sich mit einer dampfenden Schale Nudeln vor dem Lokal auf eine Bank sinken. Das heiße und scharf gewürzte Gericht vertrieb, zumindest teilweise, seine Müdigkeit. In den Reiseführer vertieft und mit den Gedanken längst bei den nächsten Stationen seiner Reise, bemerkte er die Gestalt, die vor ihn trat, zunächst nicht.
»Entschuldigen Sie.«
Als er aufblickte, sah er in das Gesicht eines etwa fünfzigjährigen Mannes, der in einem perfekt sitzenden dunkelgrauen Dreiteiler vor ihm stand. An seinem Handgelenk lugte eine goldene Uhr hervor und in den asiatischen Gesichtszügen spiegelte sich ein höfliches Lächeln.
»Ja?«
Nach einer kurzen Pause antwortete der Fremde.
»Mein Name ist Chow. Howard Chow. Bitte entschuldigen Sie den Überfall. Äußert unhöflich von mir, Sie aus Ihren Gedanken zu reißen.«
Das Lächeln wurde breiter und ohne auf eine Antwort zu warten, fuhr er fort.
»Hätten Sie unter Umständen einen Moment Zeit, sich etwas anzusehen?«
Ungläubig sah er den Mann an.
»Meinen Sie mich?«
Sein Gegenüber nickte einvernehmend.
»Ja. Wissen Sie, ich bin Kunsthändler und hier gleich nebenan befindet sich das Atelier eines jungen Künstlers, von dem ich einige Werke für meine nächste Ausstellung zu erstehen gedenke. Leider bin ich mir nicht sicher, nein – ich bin regelrecht hin und her gerissen, ob diese Objekte überhaupt die Richtigen sind.«
»Und was genau habe ich damit zu tun?«
Das Lächeln des Mannes wurde breiter, »Sie, junger Freund sind in gewisser Hinsicht ein typischer Vertreter meiner Zielgruppe.«
Als er nur einen skeptischen Blick erntete, fügte er etwas hastiger hinzu, »Die ganze Sache wird nicht zu Ihrem Schaden sein. Sagen wir … zweihundert Dollar für Ihre Meinung?«
Zweihundert! Das würde seine Reisekasse ein ordentliches Stück aufwerten. Dennoch bemerkte er den Anflug von Skepsis.
»Und ich sage Ihnen dann nur, ob mir diese Kunstwerke gefallen. Mehr nicht?«
»Exakt. Das ist alles, worum ich Sie bitte.«
Er zögerte einen Moment, dann zuckte er mit den Schultern.
»Ja. Warum nicht?«
Der Mann, der sich ihm als Howard Chow vorgestellt hatte, nickte und schickte sich an zu gehen.
»Ausgezeichnet. Folgen Sie mir bitte.«
Er stand auf und schulterte seinen Rucksack. Danach stellte er die leere Schüssel auf einen kleinen Tisch am Eingang, auf dem sich bereits etliches Geschirr anderer Gäste stapelte und folgte dem Mann. Nach etwa fünfzig Metern bog der in eine kleine Seitengasse. Da die Abenddämmerung eingesetzt hatte, bemerkte er den weißen Lieferwagen nicht, der ein Stück die Straße hinauf anhielt. Leichter Regen setzte ein.
»Wie weit ist es noch bis zu diesem Künstler?«
Die Antwort kam, ohne dass sich Chow umdrehte.
»Oh, nicht mehr weit. Sein Atelier ist gleich dort vorne.«
Er versuchte, etwas zu erkennen, aber die weißen Rauchschwaden aus den Abluftrohren der Garküchen und Berge von aufeinandergestapelten Kartons zu beiden Seiten machten dies fast unmöglich.
Sie kamen in einen kleinen Hinterhof und nach einigen Metern blieb Chow stehen.
Der nahezu kreisrunde Platz maß etwa zehn, fünfzehn Meter im Durchmesser und hatte, abgesehen von einigen alten, verrosteten Feuerleitern und kleinen, vergitterten Fenstern, Wände aus verwittertem Klinker. Von einem anderen Durchgang, als den, durch den sie gekommen waren, oder gar einer Tür fehlte jede Spur. Ein Unbehagen suchte sich den Weg durch seinen Körper.
»Mr. Chow … ich verstehe nicht. Sind wir falsch abgebogen?«
Als der Mann vor ihm keinerlei Anstalten unternahm zu antworten, versuchte er es abermals. Dieses Mal mit einem deutlich schärferen Unterton in der Stimme.
»Hey! Sehen Sie mich gefälligst an. Was soll das?«
Dieses Mal kam die Antwort augenblicklich.
»Was das soll?«, erwiderte der Mann spöttisch und ohne sich umzudrehen. »Ich glaube, Sie haben etwas, das mir gehört.«
»Eh … was? Hören Sie, ich habe beim besten Willen keine Ahnung, was Sie meinen. Geschweige denn, was das sein könnte, dass angeblich Ihnen gehört. Ich weiß nur eines – ich werde jetzt gehen!«
Ein leises, boshaftes Kichern. »Aber warum denn so eilig, mein junger Freund? Bleiben Sie doch noch ein wenig und leisten Sie uns Gesellschaft.«
Verwundert neigte er den Kopf etwas zur Seite.
»Uns?«
Der Mann, der sich Howard Chow nannte und ihm die ganze Zeit über den Rücken zugewandt hatte, drehte sich mit einem Mal langsam um und sah ihn aus kalten Augen an.
»Ja, uns.«
Dann geschah es.
Die Wände um ihn herum wurden lebendig. Schienen sich ihm entgegen zu wölben und zu verschwimmen. Die Luft flirrte und er spürte, wie sich die Haare an seinen Unterarmen langsam aufrichteten. Unmittelbar darauf explodierte ein greller Schmerz hinter seiner Stirn und ließ ihn einige Schritte zurücktaumeln. Tränen schossen ihm in die Augen und fast wäre er über eine Ansammlung zersplitterter Holzkisten gestolpert. Mehrmaliges Blinzeln. Kurz hintereinander, um sowohl die Tränen als auch den Schmerz wieder loszuwerden. Seltsam. Letzterer verschwand tatsächlich nach wenigen Sekunden. Dafür fingen jetzt seine Ohren an. Er hörte ein leises, ansteigendes Summen. In der Art, wie es die Blitze von Fotokameras von sich gaben, wenn sie sich aufluden. Das Geräusch nahm an Intensität zu, und schwer atmend zwang er sich, den Blick wieder nach vorne zu richten. Chow stand unverändert da. Herausfordernd. Lauernd. Ein Raubtier auf dem Sprung.
Sein Blick glitt an ihm vorbei zur Wand. Die sah wieder völlig normal aus. Doch dazwischen schälte sich etwas aus dem stärker werdenden Regen. Zuerst glaubte er, seine Augen spielten ihm erneut einen Streich. Sekunden später stellte er jedoch mit Entsetzen fest, dass er sich nicht geirrt hatte. Die Regentropfen fielen an mehreren Stellen nicht mehr zu Boden, sondern trafen vorher auf Widerstand. Die daraus entstandenen Umrisse sahen beinahe menschlich aus. Beinahe.
Er kniff die Augen zusammen und versuchte gleichzeitig zurückzuweichen. Aus irgendeinem Grund gelang ihm nur das Zukneifen. Angst stieg in ihm auf, als er sah, wie die gespenstischen Gestalten mehr und mehr an Substanz gewannen und sich in vier Albträume verwandelten. Nachtschwarz und mit rotglühenden Augen. Langsam traten sie in Zweiergruppen links und rechts neben Chow und blieben stehen.
Während ein nicht kleiner Teil von ihm angesichts der surrealen Situation zu kollabieren drohte, gelang es seinem Verstand dennoch, auf irgendeine Weise die Kontrolle zu behalten. Das vor ihm waren keine Monster, sondern Männer, deren Körper in mattschwarzen, gepanzerten Kampfanzügen steckten. Allerdings ähnelten diese nichts, was er vorher schon einmal gesehen hatte, sondern eher einer pervertierten Version einer … einer japanischen Samurai-Rüstung! Und wäre das nicht schon genug gewesen, trugen sie Helme, deren Form an die der Wehrmacht erinnerte. Die Gesichter waren vollständig hinter einer archaischen Maske verborgen und das rötliche Glühen der Augen offensichtlich integrierten Restlichtverstärkern zu verdanken. Im Bereich des Kinns führten zwei ebenfalls mattschwarze Schläuche über die Schultern auf den Rücken. Jeder von ihnen trug eine den Lauf nach unten gerichtete und mit einem Schalldämpfer versehene Maschinenpistole. Die Regentropfen zischten leise und verwandelten sich in feinen Wasserdampf, als sie die Oberflächen der Kampfanzüge berührten. Er machte einen Schritt auf Chow zu.
»Was zum …« Weiter kam er nicht, da eine der Gestalten blitzschnell zu ihm trat und ihm mit einem verstärkten Handschuh hart an der Schläfe traf. Abermals durchzuckte ihn ein brennender Schmerz, doch dieses Mal spürte er etwas Warmes seine Wange hinabströmen. Der Rucksack rutschte ihm von der Schulter und er sank auf die Knie. Mitten hinein in eine Pfütze, die das Regenwasser gebildet hatte. Doch die plötzliche Nässe spürte er kaum.
Chow kam langsam auf ihn zu.
Er ließ sich vor ihm in die Hocke sinken und brachte sein Gesicht nahe an sein Ohr. Seine Stimme war leise, kaum hörbar. Trotz der immer noch überlegten Ausdrucksweise verbarg sich etwas Bedrohliches darin.
»Wir können diese Episode hier umgehend hinter uns bringen. Also, noch einmal. Wie ich bereits erwähnte, haben Sie etwas das mir gehört. Wären Sie nun so freundlich und händigen mir das Fragment aus?«
Verständnislos blickte er den Mann an. Sein Blut vermischte sich mit dem Regen, lief ihm ins Auge und trübte seine Sicht.
»Das … was?«, kam es stockend. »Bitte, ich habe keine Ahnung, wovon Sie reden!«
Chow sah ihn einen Moment lang schweigend an.
»Bedauerlich. Wirklich überaus bedauerlich.«
Dann schüttelte er den Kopf, richtete sich auf und schickte sich an den Hof zu verlassen. Im Weggehen wandte er sich an denjenigen der vier, der zugeschlagen hatte. »Erledigen Sie das. Und erstatten Sie mir später Bericht.«
Die Gestalt nickte und wartete, bis Chow außer Sichtweite war. Dann zogen sie ihn grob auf die Beine. Die anderen positionierten sich in einem Halbkreis um ihn und richteten ihre Waffen auf ihn. Er versuchte, ein Schluchzen zu unterdrücken. Das misslang.
»Bitte …«, flehte er. Doch anstatt ihm zuzuhören, entsicherten die Gestalten ihre Waffen. Vier Mal erklang ein kaltes, mechanisches Klicken; sie drückten die Verschlussmechanismen nach unten. Er schloss die Augen. Das war das Ende. Musste es sein. Er wartete. Fünf Sekunden. Zehn. Aber die Schüsse blieben aus. Stoßartig und leise ließ er die Luft entweichen und öffnete blinzelnd die Augen. Die Männer hatten ihre Position verändert. Anstelle eines Halbkreises um ihn herum bildeten sie jetzt eine wie mit einem Lineal gezogene Linie. Sie schienen etwas hinter ihm zu fixieren. Die Läufe der Waffen zeigten ebenfalls dorthin. Vorsichtig wandte er den Kopf, darauf bedacht, keine hastigen Bewegungen zu machen.
Er sah … nichts.
Die Gasse lag, soweit es die wabernden Rauchschwaden erkennen ließen, leer vor ihm. Doch halt – da war noch etwas anderes. Ein schemenhaftes, bläuliches Schimmern bewegte sich langsam auf ihn zu. Er war kurz davor aufzustehen, überlegte es sich aber im letzten Moment anders, als er sich daran erinnerte, wer und was hinter ihm stand. Apropos: Die Gestalten waren geschlossen ein paar Schritte zurückgewichen. Offenbar war ihnen die neue Situation ebenfalls nicht geheuer. Er richtete den Blick wieder auf die Mitte der Gasse. Das blaue Leuchten war unverändert und sogar stärker geworden. Augenblicke später trat etwas, jemand aus dem rauchigen Vorhang. Als er das Gesicht erkannte, stöhnte er auf.
Es war die junge Frau, die ihn mit in die Stadt genommen hatte!
Sie trug ebenfalls eine Art Kampfanzug. Dieser unterschied sich allerdings grundlegend von denen der anderen. Er war schlicht, wirkte fast elegant und bis auf wenige hellere Bereiche an den Seiten in einem dunklen Grau gehalten. Einen Helm trug sie nicht, anstelle dessen schützte ein hoher, ausladender Stehkragen ihren Hals und ein Stück des Kopfes. Auch der Ursprung des Schimmerns, das er bisher nur verschwommen wahrgenommen hatte, war jetzt erkennbar: Es kam aus den Nahtstellen des Anzugs. Und es veränderte seine Intensität. Wurde heller und dann wieder dunkler. Fast so, als würde es atmen.
Sie zwinkerte ihm kurz zu und richtete den Blick dann wieder auf seine vermeintlichen Mörder.
»Sieh an, sieh an. Vier gegen einen – findet ihr das nicht etwas unfair?«
Keine Antwort. Nur die kurzen und leisen Atemgeräusche der Masken waren zu hören. Dann schnellten gleichzeitig die Mündungen der Waffen nach oben. Sie zeigte keinerlei Furcht. Wich nicht zurück. Im Gegenteil – ein fast schon schalkhaftes Lächeln stahl sich für einen kurzen Moment auf ihre Züge und sie schüttelte langsam den Kopf.
»Ihr seid drauf und dran, einen Fehler zu begehen. Vielleicht den größten Fehler eures Lebens.«, und an ihn gerichtet: »Runter!«
Hinterher war es ihm ein Rätsel, wie er es geschafft hatte, den Projektilen aus schallgedämpften Mündungen zu entkommen. Seine Beine und Unterarme schmerzten, als er der Länge nach auf dem regennassen Boden aufschlug. Dieses Mal durchnässte ihn die Pfütze vollständig. Er hob den Kopf ein wenig und schielte seitlich nach hinten, bereit, einen entsetzlich zugerichteten Körper zu sehen. Ihm stockte abermals der Atem. Das anfangs bläuliche Schimmern war zu einem hell leuchtenden, intensiven Blau geworden, das sie wie eine Aura umgab, eins mit ihr zu werden schien und die Geschosse abhielt. Anderthalb Meter vor ihr häuften sich die platt gedrückten Hülsen der Projektile.
Sie lächelte noch immer.
Seine, oder besser gesagt ihre Angreifer machten keinerlei Anstalten, das Feuer einzustellen – trotz der Tatsache, dass sie nichts gegen sie ausrichteten. Erst als der Letzte von ihnen sein Magazin verschossen hatte und nur noch leeres Klicken ertönte, senkten sie die Waffen.
»Ich habe euch doch gesagt, dass ihr einen großen Fehler begeht.«
Mit einer fließenden Handbewegung griff sie auf ihren Rücken und zog ein etwa einen Meter langes Schwert mit einer leicht gebogenen Klinge und einer gerade zulaufenden, abgeschrägten Spitze.
Ungläubig schüttelte er den Kopf und vergaß seine Angst für einen kurzen Moment.
Ein Schwert? Echt jetzt?
Doch bevor die Gedanken seinen Mund verließen, kam sie ihm zuvor.
»Eure letzte Chance. Verschwindet.«
Während sie die Worte aussprach, griff das Leuchten ihres Anzugs nach der Klinge. Unzählige Ornamente kamen zum Vorschein. Fremdartige Buchstaben und Zeichen. Zuerst leicht flackernd und dann von gleichbleibender, tiefer Intensität. Die vier Angreifer warfen die Maschinenpistolen achtlos zu Boden und zogen anstelle Teleskopschlagstöcke, zwischen deren gegabelten Enden augenblicklich Lichtbögen sichtbar wurden. Sie verlagerte im Gegenzug ihr Gewicht auf das hintere Bein, ging etwas in die Hocke und stieß sich schnell vom Boden ab. Dann flog sie. Zumindest sah es so aus. Ihr Körper beschrieb eine perfekte Drehung in der Luft. Ein einziger schneller, schneidender Laut war zu hören. Einen Wimpernschlag später landete sie hinter den Angreifern auf den Füßen.
Für einen Moment hatte es den Anschein, als wäre die Zeit stehen geblieben. Alle vier standen wie Salzsäulen da. Dann sackten sie, nahezu gleichzeitig, in sich zusammen und fielen in die Blutlachen, die sich bereits unter ihnen gebildet hatten.
Fassungslos, angewidert und interessiert zugleich starrte er auf die Körper. Die rasiermesserscharfe Klinge hatte verheerenden Schaden angerichtet und selbst vor der Panzerung keinen Halt gemacht. Fast jeder von ihnen hatte tiefe Wunden im Bauchbereich, aus denen Blut und Eingeweide quollen. Einem anderen war zusätzlich der Arm knapp über dem Ellenbogen abgetrennt worden. Und dem Letzten, dem vermeintlichen Anführer, der ihn geschlagen hatte, fehlte der Kopf. Der, nachdem er vom Oberkörper gerutscht war, mitsamt Helm einmal auf den Boden aufgeschlagen und dann knapp vor ihm zum Liegen kam.
Hastig rappelte er sich auf, rutschte dabei aus und landete auf dem Hosenboden. Panik stieg in ihm auf, und er versuchte, von dem Helm und dessen grausigem Inhalt rückwärts wegzukriechen. Dann bemerkte er sie. Das Schwert war verschwunden und sie kam langsam auf ihn zu.
»Alles in Ordnung mit dir?«
Das Erste, was er als Antwort zustande brachte, war ein angsterfüllter Schrei. Gefolgt von einem erneuten, vergeblichen Versuch, zurückzuweichen. Dieses Mal von ihr.
»Was … was war … ich«, stammelte er.
»Sssch … es kommt alles wieder in Ordnung.«
»In Ordnung …«
Sie besah sich die Wunde an seiner Schläfe und half ihm aufzustehen. Etwas wacklig kam er auf die Beine. Das fast schon grelle Leuchten an ihr war wieder zu einem sanften, kaum wahrnehmbaren Schimmer geworden. Mit der behandschuhten Rechten zeigte sie auf seinen Kopf.
»Du solltest zu einem Arzt gehen. Das da muss genäht werden.«
Mittlerweile hatte er sich wieder einigermaßen unter Kontrolle.
»Zum … Arzt?«, krächzte er. »Und was genau soll ich dem dann deiner Meinung nach erzählen? Entschuldigen Sie. Ja, mir ist da ein ganz blödes Missgeschick passiert. Ich bin in einer dunklen Gasse von einem älteren Mann und vier seiner aus dem Nichts aufgetauchten Nazi-Samurai-Leibwächter bedroht worden. Zum Glück ist dann dieses Mädchen vorbeigekommen und hat die vier, nachdem sie quasi durch die Luft geflogen ist, mit einem Schwert in Stücke geschnitten. Mit einem Schwert!«
Sie hob beschwichtigend die Hände.
»Schon gut. Ich an deiner Stelle wäre nach dem eben auch etwas durch den Wind.«
»An meiner Stelle? Durch den Wind?«
Er lachte auf und zeigte auf die Körper.
»Wer waren die? Was wollten die von mir? Und … wer oder was bist du?«
Sie griff nach seinem Rucksack, der unangetastet vor ihm am Boden lag und zog ein flaches, mattschwarzes Kästchen hervor.
»Hier. Das wollten sie von dir.«
Er blinzelte. »Was ist das? Das habe ich noch nie zuvor gesehen!«
»Ja. Schließlich habe ich es dir erst auf der Fahrt vom Flughafen hierher zugesteckt.« Sie lächelte kurz, »Sei nicht sauer, ja?« Als sie seinen Blick sah, wurde sie wieder ernst, »Tut mir leid. Wirklich.«
»Es tut dir leid? Deinetwegen wäre ich fast draufgegangen!«
Er schnaubte und griff nach dem Rucksack. Dabei streifte seine Hand zufällig das Kästchen. Augenblicklich bekam er einen kurzen, aber heftigen elektrischen Schlag.
»Ah! Fuck! Was zur Hölle ist da drin?«
»Das darf ich dir leider nicht sagen. Es ist besser, wenn du nicht mehr darüber weißt. Du hast ohnehin schon viel zu viel mitbekommen.«
»Wie bitte? Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder?« Eine kurze Pause entstand. Als die Antwort ausblieb, griff er in seine Jackentasche und holte sein Mobiltelefon hervor. »Ich rufe jetzt die Polizei an.«
Er begann die kurze Nummer des Notrufs einzugeben, als sie doch antwortete.
»Warte.«
Er hielt inne und sah sie an.
»Also schön.«
Er ließ das Telefon sinken.
»In dem Kästchen ist ein Teil eines sehr alten und ungeheuer mächtigen Gegenstands. Und um deine andere Frage zu beantworten: Die Männer sind … waren Teil einer Organisation, deren Ziel es ist, alle Teile des Gegenstands in ihre Gewalt zu bringen. Mit allen Mitteln. Wir hingegen … versuchen unser Möglichstes, damit sie dieses Ziel nicht erreichen.«
Man sah ihm an, wie er versuchte, das soeben Gehörte zu verstehen.
»Hör zu, was passiert ist … wir mussten das Kästchen ungesehen in die Stadt bringen. Das wäre ursprünglich meine Aufgabe gewesen, aber dann habe ich Chow am Flughafen gesehen. Und ich dachte, dass Du ein perfektes Ablenkungsmanöver wärst. Später hätte jemand von uns es wieder an sich genommen. Leider hat das so gar nicht geklappt.«
Ein schiefes Lächeln.
»Jemand von euch?«
»Ja, von der anderen Seite.«
Er sah sie fragend an. Sie jedoch verstaute das Kästchen in einer Tasche ihres Anzugs, drehte sich um und ging in die Gasse. Weißen Schwaden umfingen sie bereits und verwischten erneut ihre Konturen.
»Hey! Warte! Wer oder was ist die andere Seite?«
Sie hielt inne und wandte den Kopf.
»Das liegt ganz bei dir, Ben.«